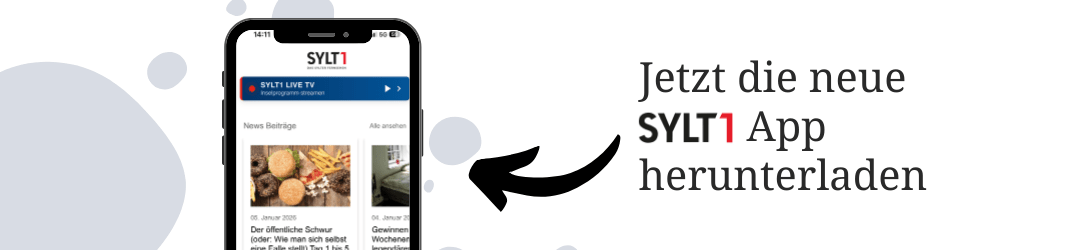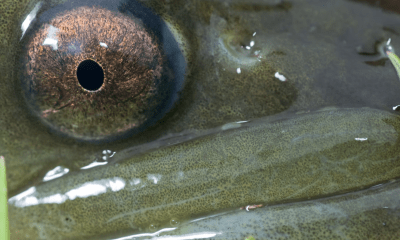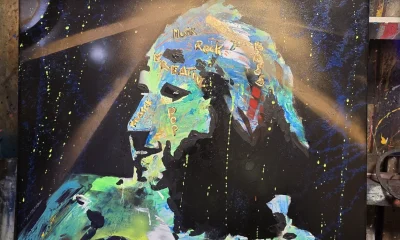Sylt, Heiligabend 1717. Der Tag neigt sich dem Ende zu. In den niedrigen Friesenhäusern auf der Osthalbinsel Nösse – in Archsum und Morsum – bereiten sich die Bauern auf das Christfest vor. Es ist kalt, und der Wind weht frisch, aber nicht ungewöhnlich für die Jahreszeit. Niemand ahnt, dass die geografische Lage ihrer Höfe in wenigen Stunden zum Verhängnis werden wird.
18:00 Uhr – Die Falle schnappt zu
Draußen auf den Marschwiesen und in den Pferchen stehen die Schafe und Rinder. Viele sind bereits in die Ställe getrieben worden, um sie vor der Winternacht zu schützen. Es ist eine verhängnisvolle Sicherheit. Als der Wind am Abend abrupt auf Nordwest dreht, wird die Nordsee zu einer unaufhaltsamen Wand.
22:00 Uhr – Ein ungleicher Kampf
Der Sturm wächst zum Orkan. Die Wellen peitschen gegen die Deiche. Doch diese Bauwerke sind schwach. Sie sind nur etwa vier Meter hoch – steile „Stackdeiche“, oft nur mit Holzplanken verstärkt. Gegen das, was nun anrollt, sind sie nutzlos. Die Flutwelle, aufgestaut in der Deutschen Bucht, erreicht Höhen von über fünf Metern über Normalnull.
Es ist kein langsames Sickern, kein einzelner Bruch. Das Wasser steigt schlichtweg anderthalb Meter höher als die Deichkronen. Die Nordsee läuft einfach über die Schutzwälle hinweg, als wären sie gar nicht da.
Mitternacht – Das Sterben in der Dunkelheit
Das Wasser schießt in die flachen Marschen von Archsum und Morsum. Es kommt schnell, wie eine Sturzflut. Für die Tiere gibt es kein Entkommen.
Die Schafe in den Ställen sind gefangen – das Wasser drückt die Türen zu oder flutet die Räume in Sekunden. Die Tiere draußen auf den Weiden sind orientierungslos. In der pechschwarzen Nacht, umtost vom Heulen des Sturms, wissen sie nicht, wohin. Das Wasser steigt schneller, als ihre kurzen Beine laufen können. Instinktiv drängen sie sich zusammen, statt zum rettenden Geestkern bei Keitum zu fliehen. Ihr Blöken geht im Lärm des Orkans unter. Tausende Kreaturen ertrinken qualvoll in der eisigen Brühe, ohne eine Chance auf Rettung.
Die Ohnmacht auf der Geest
Die Menschen haben mehr Glück – oder den besseren Instinkt. Wer kann, flüchtet sich rechtzeitig auf den höheren Geestrücken, das eiszeitliche Herz der Insel, das sich sicher über die Fluten erhebt.
Von dort oben, aus der relativen Sicherheit von Keitum oder Tinnum, starren die Familien in die Finsternis. Sie können nichts sehen, aber sie hören das Bersten ihrer Scheunen und das Brüllen der Elemente. Sie wissen in diesem Moment: Sie werden überleben, aber sie werden bettelarm sein. Ihre Lebensgrundlage, das Vieh und das fruchtbare Land, wird gerade unter ihren Füßen weggespült.
Der Morgen danach
Der erste Weihnachtstag offenbart das Ausmaß der Katastrophe. Wo gestern Marschland war, schwappt nun graues, schmutziges Wasser. Die Deiche sind nicht nur gebrochen, sie sind teils völlig geschleift. Kadaver treiben im Wasser, das Salz hat sich tief in den Boden gefressen.
Sylt hat in dieser Nacht keine Menschenleben verloren – ein Wunder im Vergleich zum Festland. Doch der Preis ist hoch: Die Flut hat die Inselwirtschaft um Jahrzehnte zurückgeworfen. Es ist ein stilles, bitteres Weihnachten, geprägt vom Verlust und der demütigen Erkenntnis, dass gegen eine Flut, die höher ist als jeder Deich, kein Kraut gewachsen ist.