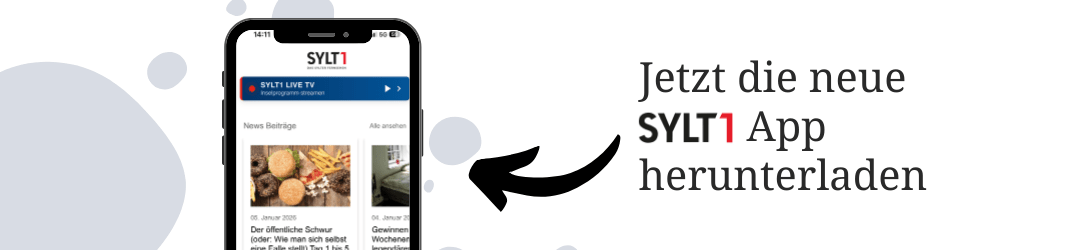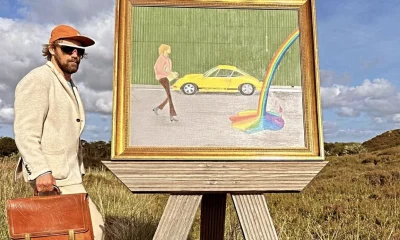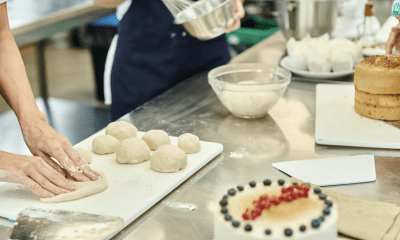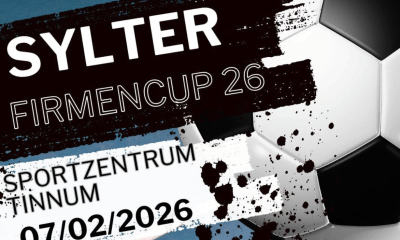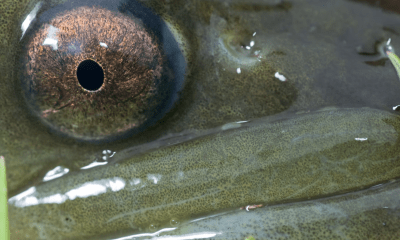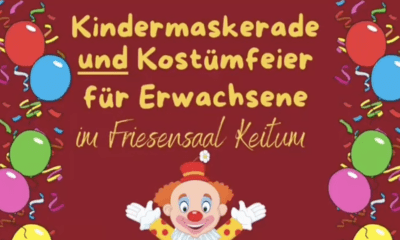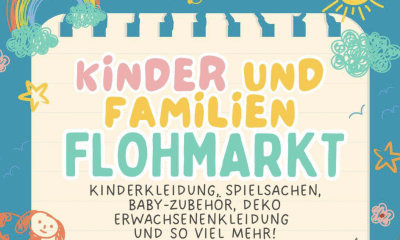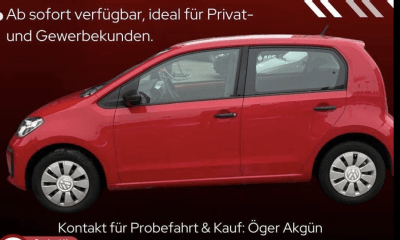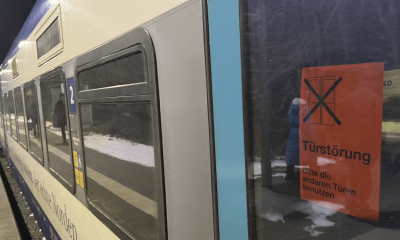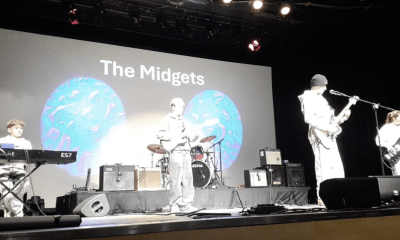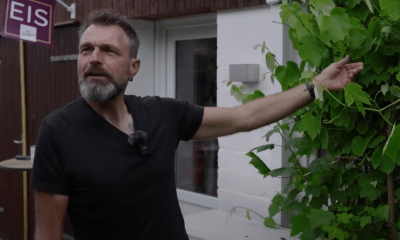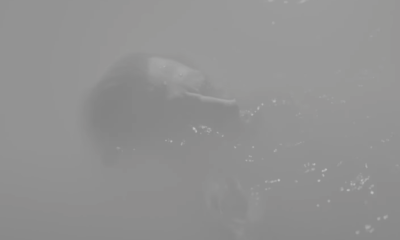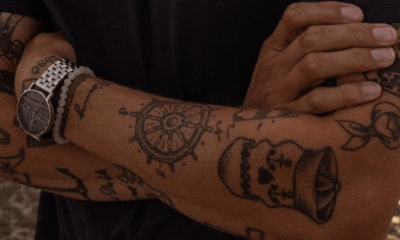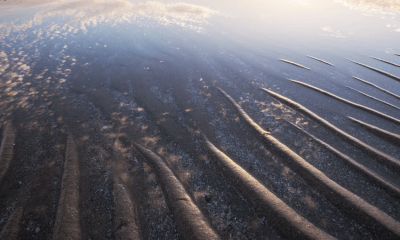Allgemein
Der Konflikt um den B-Plan 28 auf Sylt – eine Aufarbeitung

I. Die Eskalation des Nutzungskonflikts auf Sylt
A. Zentrale Konfliktpunkte und die Ablehnung durch die Höheren Planungsbehörden
Der Kern des aktuellen planungsrechtlichen Konflikts auf Sylt liegt in der geplanten Änderung des Bebauungsplans (B-Plan) 28 im Ortsteil Westerland. Die Gemeinde Sylt verfolgt das Ziel, das bisherige, mutmaßlich dauerwohngeprägte allgemeine Wohngebiet in ein „Sondergebiet für Dauerwohnen und Touristenbeherbergung“ umzuwandeln. Diese Umwidmung würde Ferienwohnungen und Zweitwohnungen grundsätzlich zulassen – Nutzungen, die im Plangebiet 28 bislang unzulässig waren.
Die zentrale Kritik des Kreises Nordfriesland und der Landesplanung Schleswig-Holstein richtet sich gegen die implizierte Verschiebung des Nutzungsschwerpunktes weg vom Dauerwohnen hin zu einer touristischen Nutzung Die Ablehnung basiert auf mehreren entscheidenden Punkten: Erstens widerspricht die Planung dem eigenen Wohnungsmarktkonzept der Gemeinde, das einen Mangel an Dauerwohnraum feststellt. Zweitens fehlen nach Ansicht der Landesplanung nachvollziehbare städtebauliche Gründe, um von den gemeindlichen Konzepten abzuweichen. Die Landesplanung hat sich in ihrer Stellungnahme explizit der Bewertung des Kreises Nordfriesland angeschlossen .
B. Strategischer Dissens und die Priorität der Legalisierung
Der Konflikt verdeutlicht einen tiefgreifenden strategischen Dissens über die Vorgehensweise zur Bewältigung der Baurechtskrise auf der Insel. Die höheren Planungsbehörden halten das gesamte Vorgehen der Gemeinde für fehlerhaft (falsches Vorgehen), da in weiten Teilen von Sylt nicht genehmigte Ferien- und Zweitwohnungen existieren. Sie fordern dringend ein systematisches Vorgehen: Zuerst müsse ein Gesamtkonzept entwickelt und dieses dann in den Bebauungsplänen umgesetzt werden, nicht umgekehrt
Das kommunale Vorgehen, wie es exemplarisch im B-Plan 28 zum Ausdruck kommt, wird von Kritikern als reaktive Planung interpretiert, die primär auf die nachträgliche Legalisierung illegaler Bestände abzielt. Die Gemeinde steht unter erheblichem Druck der Kreisverwaltung und des Immobilienmarktes, schnell Voraussetzungen für die rechtssichere Nutzung von Ferienobjekten zu schaffen. Der B-Plan 28 sollte dabei als sogenannte „Blaupause“ oder „Muster-Bebauungsplan“ für die gesamte Insel dienen. Die Gefahr dieses Musters besteht darin, dass eine erfolgreiche Durchsetzung, die den Fokus zugunsten des Tourismus verschiebt, die planungsrechtliche Erosion von Dauerwohngebieten auf der gesamten Insel beschleunigen könnte. Dies konterkariert die Ziele der Daseinsvorsorge, die im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein verankert sind.
C. Strategische Empfehlungen zur Überwindung der Planungskrise
Um die Rechtsunsicherheit und das Risiko eines späteren Normenkontrollverfahrens zu minimieren, wird eine grundsätzliche Überarbeitung des B-Plans 28 auf Basis der Stellungnahmen von Kreis und Land empfohlen. Die Gemeinde ist gefordert, einen städtebaulichen Rahmenplan (Masterplan) zu erstellen , der die Nutzungskonkurrenzen auf der gesamten Insel systematisch klärt und die Anpassungspflicht an die Ziele der Raumordnung (Sicherung des Dauerwohnens) prioritär erfüllt. Die Sicherung des Dauerwohnens muss dabei über formale 50%-Regelungen hinausgehen und substanziell gewährleistet werden.
II. Grundlagen der Planungskrise: Das Spannungsfeld zwischen Dauerwohnen und Tourismus
A. Der Wohnraum-Mangel auf Sylt und die Daseinsvorsorge
Die Insel Sylt kämpft seit Langem mit einem akuten Mangel an Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung. Diesen Umstand hat die Gemeinde Sylt selbst im Rahmen ihres Wohnungsmarktkonzeptes bereits festgestellt: Die vorhandenen und aktivierbaren Flächen für Dauerwohnraum reichen nicht aus [Query text].
Diese kommunale Feststellung steht in direktem Konflikt mit den Vorgaben der übergeordneten Planungsebenen. Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind Gemeinden zur Anpassung ihrer Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung verpflichtet. Diese Ziele sind im Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP) festgelegt. Ein Kernziel der Raumordnung auf Sylt ist die Sicherung der Daseinsvorsorge. Die Möglichkeit für Einheimische und Beschäftigte, bezahlbaren Dauerwohnraum zu finden, ist eine notwendige Voraussetzung, um die Funktionsfähigkeit der Daseinsvorsorge (etwa in den Bereichen Infrastruktur, Bildung und Gesundheitswesen) zu gewährleisten. Die geplante allgemeine Zulassung von Zweitwohnungen im Plangebiet 28 [Query text] wird von der Landesplanung als nicht nachvollziehbar kritisiert, da Zweitwohnungen Dauerwohnraum entziehen und die Versorgungsstruktur weiter schwächen
.
B. Die Baurechtliche Ausgangssituation: Die Flut der ungenehmigten Ferienwohnungen
Die Notwendigkeit zur Änderung des B-Plans 28 entspringt einer jahrelang gewachsenen Baurechtskrise. Auf Sylt besteht ein riesiges Problem mit ungenehmigten („illegalen“) Ferienwohnungen. Das Ausmaß der Fehlnutzung ist signifikant; Berichten zufolge sollen in Gebieten wie Wenningstedt rund 85 Prozent des Wohnungsbestands bauplanungsrechtlich unzulässig als Ferienwohnungen betrieben werden.
Dieser Zustand hat die Politik unter massiven Vollzugsdruck der Kreisverwaltung Nordfriesland gesetzt. Die Gemeindevertreter müssen schnellstmöglich planungsrechtliche Voraussetzungen schaffen, um die Nutzung von Ferienobjekten auf eine rechtlich sichere Grundlage zu stellen. Die primäre Motivation hinter dem B-Plan 28 ist demnach nicht die zukunftsgerichtete städtebauliche Steuerung, sondern die reaktive Konsolidierung und Legalisierung eines über Jahre entstandenen illegalen Status quo.
Die Folge des Vollzugsdrucks durch den Kreis war eine Verunsicherung der Immobilienbranche, was bereits zu sinkenden Preisen und zur Rückkehr erster Wohnungen auf den Dauerwohnmarkt führte. Der Versuch, nun über planungsrechtliche Änderungen wie den B-Plan 28 eine massenhafte Legalisierung vorzunehmen, dient dazu, diesen Druck zu mindern. Landrat Florian Lorenzen hat jedoch bereits klargestellt, dass eine pauschale, rückwirkende Genehmigung unzulässiger Nutzungen über einen Zeitraum von 45 Jahren hinweg von der rechtlichen Lage auf keinen Fall zugelassen wird. Dies verdeutlicht, dass selbst die weitgehende B-Plan-Änderung nur einen Teil des Problems lösen kann. Die Priorisierung der Legalisierung illegaler Nutzungen, während gleichzeitig die eigenen Konzepte zum Dauerwohnraum ignoriert werden, führt zu einer planungsrechtlichen Erosion der Glaubwürdigkeit der Kommune, den Mangel an Dauerwohnraum ernsthaft beheben zu wollen.
III. Die Geplante Änderung des B-Plans 28: Rechtsform und Nutzungspriorisierung
A. Transformation des Plangebiets: Vom Allgemeinem Wohngebiet zum Sondergebiet (§ 11 BauNVO)
Die geplante Änderung sieht die Umwandlung eines ehemals dauerwohngeprägten Gebiets, das einst der Sicherung von Wohnraum für Insulaner dienen sollte, in ein Sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vor. Sondergebiete sind für Nutzungen vorgesehen, die sich von den klassischen Baugebieten (§§ 2 bis 10 BauNVO) wesentlich unterscheiden.
Die Gemeinde Sylt versucht, den Anspruch auf Dauerwohnen innerhalb dieses neuen Sondergebiets formal zu sichern. Gemäß dem Planentwurf (Vorentwurf) sollen „mindestens 50 Prozent der zulässigen Geschossfläche als Dauerwohnraum zu nutzen“ sein. Das sonstige Sondergebiet soll vorwiegend sowohl dem Dauerwohnen der ortsansässigen Bevölkerung als auch dem Ferienwohnen dienen.
B. Zulässigkeit von Mischformen und die Tücke der 50%-Quote
Die grundsätzliche Zulässigkeit von Sondergebieten, die ständige Wohnnutzung und Ferienwohnungen in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang kombinieren, wurde vom Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) bestätigt. In der Rechtsprechung wurde festgestellt, dass solche Festsetzungen wirksam sind, sofern sie hinreichend bestimmt sind.
Die Kritik der höheren Planungsbehörden zielt jedoch auf die Substanz der Planung ab, nicht auf die bloße Form des Sondergebiets. Die Festsetzung einer 50%-Quote für Dauerwohnen wird als eine de-facto-Freigabe der anderen 50% der Geschossfläche für touristische Nutzung interpretiert, was eine massive Freigabe in einem ehemals dauerwohngeprägten Areal darstellt.
Im Kontext eines festgestellten Dauerwohnraummangels ist die städtebauliche Erforderlichkeit einer Planung, die bis zu 50% der Flächen für Tourismus und generell für Zweitwohnungen freigibt, hochgradig angreifbar [Query text]. Die Umwandlung von Dauerwohngebiet zu einem Sondergebiet, das touristische Nutzung zu 50% erlaubt, ist keine Sicherung des Dauerwohnraums im Sinne einer Priorisierung des Gemeinwohls (§ 1 Abs. 6 BauGB), sondern eine Beschränkung des Dauerwohnens auf ein gerade noch akzeptables Niveau, um die weitreichende touristische Nutzung zu legalisieren und zu ermöglichen. Dies wird als Indiz für einen Wägefehler gewertet, da das Schutzbedürfnis der Dauerwohnbevölkerung nicht ausreichend gewichtet wurde, obwohl es durch die eigenen Wohnraumkonzepte belegt ist.
Der folgende Vergleich fasst die Diskrepanz zwischen den geplanten Festsetzungen und der Kritik der höheren Ebenen zusammen:
| Planungsparameter | B-Plan 28 (Entwurf Gemeinde Sylt) | Kritikpunkt Kreis/Land | Juristische Relevanz |
|---|---|---|---|
| Gebietsart | Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO) | Verschiebung des Nutzungsschwerpunkts von Wohnen zu Tourismus | Formal zulässig, aber städtebauliche Erforderlichkeit fraglich |
| Dauerwohnquote | Mindestens 50% der Geschossfläche | De-facto-Freigabe von bis zu 50% für Tourismus in ehemals DW-Gebiet | Gefahr des Wägefehlers (§ 1 Abs. 7 BauGB) durch unzureichende Gewichtung des Dauerwohnschutzes. |
| Zweitwohnungen | Grundsätzlich zugelassen | Nicht nachvollziehbar, da Zweitwohnungen DW-Raum entziehen | Verstoß gegen das Ziel der Sicherung von Dauerwohnraum. |
| Anlass der Planung | Notwendigkeit zur Legalisierung illegaler Bestände | Falsches Vorgehen: Priorisierung der Legalisierung statt der Gesamtkonzept-Entwicklung | Konflikt mit der Pflicht zur Anpassung an die Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB). |
| IV. Die Ablehnung durch Kreis und Landesplanung: Eine Analyse der Rechtseinwände | |||
| A. Fehlende Nachvollziehbare Städtebauliche Gründe | |||
| Die Landesplanung Schleswig-Holstein unterstützt die Bewertung des Kreises Nordfriesland, indem sie fehlende, nachvollziehbare städtebauliche Gründe für die Abweichung von den kommunalen Konzepten sieht . Diese Kritik berührt das zentrale bauplanungsrechtliche Erfordernis: Nach § 1 Abs. 3 BauGB muss Bauleitplanung erforderlich sein. Die städtebauliche Erforderlichkeit einer Planung, die Dauerwohnraum zugunsten touristischer Nutzung reduziert, kann schwerlich begründet werden, wenn die Gemeinde gleichzeitig einen Mangel an Dauerwohnraum feststellt. | |||
| Das Argument zielt darauf ab, dass die Planung nicht dem Gemeinwohl dient, sondern primär den wirtschaftlichen Interessen der Legalisierung illegaler Nutzungen. Die Kritiker warnen, dass der Entwurf des B-Plans 28 den Schutz von Dauerwohnraum negiert und die letzten funktionierenden Nachbarschaften in Westerland keine Überlebenschance mehr hätten, was sozialen Verwerfungen Vorschub leistet. Die Umwandlung führt somit zu einem Funktionsverlust, der den Zielen gesunder Wohnverhältnisse im Sinne des BauGB widerspricht. | |||
| B. Verletzung der Anpassungspflicht an die Ziele der Raumordnung | |||
| Ein entscheidender juristischer Einwand ist die mögliche Verletzung der Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB. Die Bauleitplanung der Gemeinden muss an die Ziele der Raumordnung angepasst werden, die im Landesentwicklungsplan (LEP) festgelegt sind. Die landesplanerischen Ziele sehen die Sicherung der Daseinsvorsorge auf der Insel Sylt vor, wofür die Gemeinden verstärkt zusammenarbeiten sollen. | |||
| Indem der B-Plan 28 den Schwerpunkt der zulässigen Nutzung hin zur touristischen Nutzung verschiebt und Zweitwohnungen allgemein zulässt [Query text], wird direkt den Zielen der Daseinsvorsorge zuwidergehandelt. Dauerwohnraum ist die Basis für die soziale und funktionale Infrastruktur einer Gemeinde. Wenn diese Basis durch Planungen geschwächt wird, die im Grunde eine Ausweitung der Ferienwohnnutzung in vormals geschützten Gebieten ermöglichen , widerspricht dies den Grundsätzen des LEP. Die Landesplanung fungiert in diesem Fall als Regulierungsinstanz, die das übergeordnete öffentliche Interesse – nämlich die Sicherung des Lebensraums und der sozialen Kohäsion – gegen die kurzfristigen ökonomischen Interessen der Legalisierung schützt. Solange die Gemeinde keine schlüssigen Gesamtkonzepte vorlegt, die den Mangel an Dauerwohnraum glaubhaft beheben, kann die Landesplanung keine Ad-hoc-Legalisierung touristischer Fehlnutzungen akzeptieren. | |||
| C. Die drohende Planunwirksamkeit | |||
| Die offene und explizite Ablehnung des B-Plans durch Kreis Nordfriesland und Landesplanung signalisiert ein erhebliches Risiko für die spätere Rechtsbeständigkeit des Bebauungsplans. Sollte die Gemeinde Sylt den Plan trotz dieser Bedenken im Satzungsbeschluss verabschieden, wäre er hochgradig anfällig für ein Normenkontrollverfahren gemäß § 47 VwGO. | |||
| Hauptangriffspunkte in einem solchen Verfahren wären die Verletzung des Abwägungsgebots (§ 1 Abs. 7 BauGB) und die Nichtbeachtung der Anpassungspflicht an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB). Ein Bebauungsplan, der die Erfordernisse der Daseinsvorsorge (Dauerwohnen) zugunsten der Legalisierung touristischer Fehlnutzungen in einem Maße ignoriert, das den eigenen kommunalen Konzepten widerspricht, läuft Gefahr, vom zuständigen Gericht als unwirksam erklärt zu werden. | |||
| V. Das Erforderliche Systematische Vorgehen: Gesamtkonzept statt Ad-hoc-Planung | |||
| A. Die Forderung nach einem städtebaulichen Rahmenplan | |||
| Die zentrale Forderung von Kreis und Land ist die Entwicklung eines systematischen Gesamtkonzepts oder städtebaulichen Rahmenplans, bevor Bebauungspläne zur Legalisierung von Ferienwohnungen geändert oder aufgestellt werden. Die Gemeinde Sylt agiert derzeit reaktiv, indem sie unter politischem Druck das Problem der illegalen Ferienvermietung durch isolierte Änderungen wie den B-Plan 28 zu lösen versucht. | |||
| Experten betonen, dass ein unmittelbares Anpassen von Einzelplänen, um möglichst viele bislang ungenehmigte Ferienwohnungen in die Genehmigungsfähigkeit zu führen, kein zwingend notwendiges städtebauliches Gesamtgefüge schaffen kann. Städtebauliche Rahmenpläne hingegen dienen als Masterplan dazu, besondere Problemlagen und Nutzungskonkurrenzen (Dauerwohnen versus Fremdenbeherbergung) vorab in einem Planungsraum zu klären. Nur ein solcher Masterplan ermöglicht eine koordinierte und gerechte Steuerung der Nutzungsarten über die gesamte Insel hinweg. | |||
| B. Institutionelle Kooperation und die Rolle des Vollzugs | |||
| Das Fehlen eines klaren städtebaulichen Rahmens erschwert den Vollzug des Baurechts. Ohne eindeutige Planungsziele führt der Versuch, ungenehmigte Ferienwohnungen zu untersagen, zu Massengeschäften bei der Bauaufsicht. Die politische Chronologie zeigt, dass die Krise der illegalen Ferienwohnungen lange ignoriert wurde (Verfahren des B-Plan 28 wurde zwar 2018 angestoßen, gerät aber erst Jahre später unter Zeitdruck ), und nun unter hohem Zeitdruck gelöst werden soll. Dieser Zeitdruck ist der Hauptgrund für das isolierte Ad-hoc-Vorgehen der Gemeinde, anstatt den zeitaufwändigeren, aber rechtlich robusteren Masterplan-Ansatz zu verfolgen. | |||
| Um zukünftige Fehlanreize und Rechtsunsicherheit zu vermeiden, haben sich der Kreis Nordfriesland und die Sylter Gemeinden darauf verständigt, Quartalsgespräche abzuhalten, in denen das Kreisbauamt die Gemeinden bei Fragen der Bauleitplanung berät und den Verfahrensfortgang bespricht. Dies ist ein wichtiger Schritt zur institutionellen Zusammenarbeit, um die gesetzliche Pflicht zur Kooperation bei der Sicherung der Daseinsvorsorge zu erfüllen und ein abgestimmtes Vorgehen zu gewährleisten. | |||
| C. Bewertung des B-Plan 28 als „Blaupause“: Risiko und Chance | |||
| Der B-Plan 28 soll als Musterplan dienen, um die Baurechtskrise in den Griff zu bekommen. Wird dieser Plan jedoch trotz der ablehnenden Stellungnahmen der höheren Planungsbehörden durchgesetzt, etabliert er einen gefährlichen Präzedenzfall: Die lokale Planungshoheit setzt sich über die Anpassungspflicht an die Ziele der Raumordnung hinweg, und die Legalisierung von touristischen Fehlnutzungen wird prioritär behandelt. | |||
| Die Planung muss daher sicherstellen, dass sie nicht nur wirtschaftlichen Interessen dient, sondern auch Instrumente wie Erhaltungssatzungen (§ 172 BauGB) zur Erhaltung der Eigenart der Gebiete und Fremdenverkehrssatzungen (§ 22 BauGB) zur Sicherung der touristischen Funktion angemessen berücksichtigt. Die derzeitige Ausgestaltung des B-Plans 28 signalisiert eine Priorisierung der Tourismusfunktion, die den Anforderungen an eine ausgewogene städtebauliche Entwicklung im Kontext des Dauerwohndefizits nicht gerecht wird. | |||
| Der folgende Vergleich verdeutlicht den strategischen Konflikt zwischen der lokalen und der übergeordneten Planung: | |||
| Table Title | |||
| Planungsansatz | Gemeinde Sylt (B-Plan 28) | Kreis/Landesplanung (Forderung) | Strategische Konsequenz |
| — | — | — | — |
| Auslöser der Planung | Vollzugsdruck und Wunsch nach Legalisierung illegaler Fewos | Notwendigkeit zur Korrektur städtebaulicher Fehlentwicklungen und Sicherung der Daseinsvorsorge | Reaktives vs. Proaktives Handeln |
| Geltungsbereich | Isoliertes Plangebiet (B-Plan 28 als Muster) | Flächendeckendes, systematisches Vorgehen (Rahmenplan/Masterplan) | Fragmentierung vs. Kohärenz der Planung |
| Risikobewertung | Hohes juristisches Risiko der Planunwirksamkeit aufgrund der Ablehnung durch die Landesplanung [Query text] | Sicherung der Rechtskonformität durch Einhaltung der Anpassungspflicht (§ 1 Abs. 4 BauGB) | Unmittelbare Rechtsunsicherheit vs. Langfristige Rechtssicherheit |
| Priorität der Nutzung | Gleichgewicht/Shift zu 50% touristischer Nutzung | Stärkung des Dauerwohnens als Primat zur Sicherung der sozialen Infrastruktur [Query text] | Wirtschaftlicher Tourismus vs. Sozialer Wohnraumschutz |
| VI. Strategische Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen für die Gemeinde Sylt | |||
| A. Juristisches Risiko und Vermeidung des Normenkontrollverfahrens | |||
| Die Analyse legt nahe, dass der aktuelle Entwurf des B-Plans 28 in seiner vorgesehenen Form ein erhebliches Risiko der Planunwirksamkeit aufweist. Die explizite Ablehnung durch Kreis Nordfriesland und Landesplanung aufgrund fehlender städtebaulicher Gründe und der Verschiebung des Nutzungsschwerpunktes hin zum Tourismus ist ein klares Indiz für wahrscheinliche Verstöße gegen das Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) und die Anpassungspflicht an die Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB) [Query text]. | |||
| Handlungsempfehlung I: Die Gemeinde Sylt sollte das laufende Satzungsverfahren zum B-Plan 28 stoppen und den Entwurf grundlegend überarbeiten. Dies sollte in enger Abstimmung mit den höheren Planungsbehörden geschehen, um die beanstandeten Mängel zu beheben und einen späteren, langwierigen Rechtsstreit zu vermeiden. | |||
| B. Strategische Neuausrichtung: Priorisierung des Dauerwohnens | |||
| Um den Zielen der Daseinsvorsorge und dem eigenen Wohnungsmarktkonzept gerecht zu werden, muss die Gemeinde Sylt den Schutz des Dauerwohnraums glaubhaft in den Vordergrund stellen. Die Festsetzung einer 50%-Quote für Dauerwohnen in einem ehemals dauerwohngeprägten Gebiet ist keine Stärkung, sondern eine Akzeptanz des Funktionsverlustes. | |||
| Handlungsempfehlung II: Sollte die Gemeinde am Instrument des Sondergebiets (§ 11 BauNVO) festhalten, muss die Mindestquote für Dauerwohnen signifikant erhöht werden (deutlich über 50%). Dies würde sicherstellen, dass der Schwerpunkt der zulässigen Nutzung nachweislich dem Dauerwohnen und der Sicherung der lokalen Bevölkerung dient und somit die städtebauliche Erforderlichkeit im Kontext des Wohnungsmangels untermauern. | |||
| C. Empfehlungen zur Kooperation und zur Erstellung eines Gesamtkonzepts | |||
| Die Bewältigung der Baurechtskrise auf Sylt kann nicht durch isolierte Ad-hoc-Planungen wie den B-Plan 28 erfolgen. Das Problem der ungenehmigten Ferienwohnungen ist flächendeckend und erfordert eine systematische Lösung. | |||
| Handlungsempfehlung III: Der Masterplan-Ansatz: Die Gemeinde Sylt muss unverzüglich die Erstellung eines umfassenden städtebaulichen Gesamtkonzepts oder Masterplans initiieren, der die räumliche Steuerung der verschiedenen Nutzungsarten (Dauerwohnen, Ferienwohnen, Zweitwohnen) über die gesamte Insel koordiniert. Dieses Konzept muss die Konflikte systematisch auflösen und die Vorgaben des Landesentwicklungsplans verbindlich umsetzen. Die Nutzung der vereinbarten Quartalsgespräche mit dem Kreisbauamt ist dabei unerlässlich, um die Planungen von Beginn an rechtskonform und konsensfähig zu gestalten. Nur ein abgestimmtes, systematisches Vorgehen kann langfristig den Rechtsfrieden wiederherstellen und das kritische Gleichgewicht zwischen Wirtschaftsraum und Lebensraum auf der Insel Sylt sichern. |
Es ist zwar ein formal korrekter politischer Prozess, doch die Umstände legen den Schluss nahe, dass eine politische Mehrheit ein klares Ziel – mehr Ferienwohnungen – gegen erhebliche Widerstände und die offensichtliche Wohnungsnot durchsetzt.